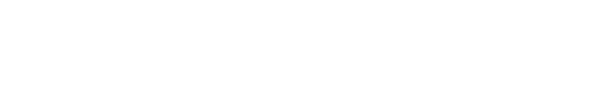Aufmerksamkeit und selbstverletzendes Verhalten bei Jugendlichen
Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV; engl. nonsuicidal self-injury) stellt ein schwerwiegendes klinisches Problem im Jugendalter dar, da es mit einem erhöhten Risiko für psychische Komorbiditäten sowie mit erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität und Alltagsbewältigung einhergeht. Zudem ist NSSV häufig mit suizidalem Verhalten assoziiert (2). Die weltweiten Prävalenzschätzungen bei Jugendlichen liegen bei etwa 16–17% (3,4). NSSV bezeichnet absichtliche, wiederholte Selbstverletzungen ohne suizidale Absicht (5), darunter Verhaltensweisen wie Schneiden, Kratzen, Verbrennen oder das Schlagen gegen Gegenstände, um Blutergüsse oder Blutungen zu verursachen. Bei Betroffenen dient NSSV häufig der dysfunktionalen Regulation von Emotionen und Stress (6).
Soziale Medien spielen eine zentrale Rolle im Alltag von Jugendlichen. Es wird häufig angenommen, dass der Konsum NSSV-bezogener Inhalte auf sozialen Medien potenziell als Auslöser („Trigger“) für selbstverletzendes Verhalten wirken kann (7). Der Einfluss sozialer Medien beschränkt sich dabei nicht nur auf das Verhalten, sondern betrifft auch Aufmerksamkeitsprozesse – insbesondere dann, wenn Jugendliche mit potenziell belastenden Inhalten (z. B. Abbildungen von Wunden oder Klingen) konfrontiert werden. Unsere Studie untersucht daher, ob durch NSSV-Abbildungen bzw. NSSV-Texte bei Jugendlichen mit und ohne NSSV-Vorgeschichte NSSV-Dränge („Urges“) oder physiologische Stressreaktionen ausgelöst werden können.
In dem Nonrandomized Controlled Trial wurden 50 Jugendliche untersucht (25 mit NSSV, 25 gesunde Kontrollteilnehmer:innen). Zur Erfassung von Aufmerksamkeitsverzerrungen kamen Eye-Tracking und ein Dot-Probe-Paradigma zum Einsatz. Beim Eye-Tracking werden mittels Infrarotlicht Augenbewegungen wie Fixationen und Sakkaden präzise erfasst. Das Dot-Probe-Paradigma misst Reaktionszeiten, indem den Teilnehmer:innen zwei Reize gleichzeitig präsentiert werden – einer davon emotional bedeutsam (z. B. ein NSSV-Stimulus) – gefolgt von einem Punkt, auf den so schnell wie möglich reagiert werden muss.
Unsere Studie zeigte, dass Jugendliche mit NSSV im Eye-Tracking eine Aufmerksamkeitsverzerrung gegenüber NSSV-Bildern aufwiesen, die mit einem erhöhten selbstberichteten Drang zur Selbstverletzung einherging. Bei den gesunden Jugendlichen der Kontrollgruppe ließ sich dieser Effekt nicht beobachten. Dieser Befund konnte experimentell durch die zweite Aufgabe (Dot-Probe-Paradigma) repliziert werden. Für NSSV-Texte hingegen zeigten sich in beiden Gruppen weder signifikante autonome Erregungen noch Aufmerksamkeitsverzerrungen.
Die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen eine spezifische Aufmerksamkeitsverzerrung gegenüber NSSV-Bildern bei Jugendlichen mit NSSV, die mit einem erhöhten Drang zur Selbstverletzung einhergeht. Dies legt nahe, dass visuelle NSSV-Inhalte – wie sie etwa in sozialen Medien verbreitet sind – bei Jugendlichen mit entsprechender Vorgeschichte potenziell als sogenannte „Trigger“ wirken und vermehrt Selbstverletzungsdränge auslösen können. Umgekehrt zeigen die Befunde, dass der Konsum solcher Inhalte bei gesunden Jugendlichen nicht zwangsläufig zu entsprechenden Drängen oder selbstverletzendem Verhalten führen muss.
Zusammenfassend unterstreichen die Studienergebnisse die Notwendigkeit, emotionale Regulationsfähigkeiten zu stärken und adaptive Bewältigungsstrategien zu fördern – insbesondere bei Jugendlichen im Umgang mit sozialen Medien. Kliniker:innen sollten sich der potenziellen Triggerwirkung von NSSV-Inhalten bewusst sein, das Thema gezielt explorieren und betroffene Patient:innen entsprechend unterstützen.
Wissenschaftliches Umfeld
Seit 2022 ist Dr. Andreas Goreis als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Postdoc in der Arbeitsgruppe von Ap.Prof. Oswald Kothgassner an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig. Der Schwerpunkt seiner wissenschaftlichen Arbeit liegt an der Schnittstelle von Grundlagenforschung und klinischer Anwendung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wobei er sich insbesondere mit Stress und stressassoziierten Störungsbildern befasst.
Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die (neuro-)endokrine, physiologische und subjektive Stressreaktivität sowie deren Modulation bei der Entstehung und Chronifizierung psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter zu verstehen. Neben Experimentalstudien setzt Dr. Goreis gemeinsam mit der Arbeitsgruppe auch hormonelle Verfahren und sogenannte Alltagsstudien (Ambulatory Assessments) ein, um Stress und seine Folgen möglichst valide und umfassend zu erfassen.
Im Rahmen dieser Projekte kooperiert die Arbeitsgruppe mit internationalen Partner:innen, darunter Prof.in Laurence Claes von der KU Leuven, mit der auch diese Publikation entstanden ist. Zudem wurde Dr. Goreis für diese Studie auf der letzten Fachtagung des psychologischen Fachgremiums der Medizinischen Universität Wien mit dem Rudolf-Quatember-Preis ausgezeichnet.
Zu den Personen
Dr. Andreas Goreis studierte Psychologie an der Universität Wien. Anschließend war er vier Jahre lang an der Universität Wien tätig, wo er auch das Doktoratsstudium absolvierte und seine Dissertation zum Thema Stress und stressassoziierte Störungen verfasste. Seit Juli 2022 ist Dr. Goreis als Postdoc an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Medizinischen Universität Wien tätig. Neben seiner Forschung engagiert er sich auch in der Lehre im Rahmen des Humanmedizinstudiums sowie des Psychologiestudiums an der Universität Wien und betreut Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten.
Ausgewählte Literatur
- Goreis A, Pfeffer B, Hajek Gross C, et al. Attentional Biases and Nonsuicidal Self-Injury Urges in Adolescents. JAMA Netw Open. 2024;7(7):e2422892. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.22892
- Castellví P, Lucas-Romero E, Miranda-Mendizábal A, et al. Longitudinal association between self-injurious thoughts and behaviors and suicidal behavior in adolescents and young adults: A systematic review with meta-analysis. Journal of Affective Disorders. 2017;215:37-48. doi:10.1016/j.jad.2017.03.035
- Farkas BF, Takacs ZK, Kollárovics N, Balázs J. The prevalence of self-injury in adolescence: a systematic review and meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry. Published online July 24, 2023. doi:10.1007/s00787-023-02264-y
- Swannell SV, Martin GE, Page A, Hasking P, St John NJ. Prevalence of Nonsuicidal Self-Injury in Nonclinical Samples: Systematic Review, Meta-Analysis and Meta-Regression. Suicide and Life-Threatening Behavior. 2014;44(3):273-303. doi:10.1111/sltb.12070
- Lloyd-Richardson EE, Perrine N, Dierker L, Kelley ML. Characteristics and functions of non-suicidal self-injury in a community sample of adolescents. Psychol Med. 2007;37(8):1183-1192. doi:10.1017/S003329170700027X
- Goreis A, Prillinger K, Bedus C, et al. Physiological stress reactivity and self-harm: A meta-analysis. Psychoneuroendocrinology. 2023;158:106406. doi:10.1016/j.psyneuen.2023.106406
- Dyson MP, Hartling L, Shulhan J, et al. A Systematic Review of Social Media Use to Discuss and View Deliberate Self-Harm Acts. Seedat S, ed. PLoS ONE. 2016;11(5):e0155813. doi:10.1371/journal.pone.0155813